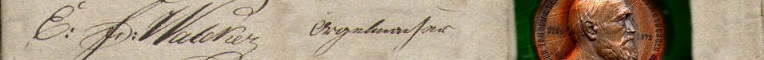(7)
EBERHARD FRIEDRICH WALCKER
DIE ORGEL IN AGRAM
Ein ganz besonderer Nimbus verband sich für Eberhard Friedrich offenbar mit der Orgel für die Erzbischöfliche Kathedrale in Agram, die ganz in die Zeit der Münster-Orgel in Ulm hereinkommt. Er wurde im Jahre 1852 zu Verhandlungen über den Bau einer Orgel für diese Kirche vom dortigen Erzbischof nach Agram berufen, entwarf auch gleich an Ort und Stelle eine entsprechende Disposition und Kostenvoranschlag und konnte schon in kurzer Zeit den perfekten Auftrag mit heimnehmen. Nach drei Jahren war in Ludwigsburg die Orgel versandfertig, und in den Monaten September, Oktober und Anfang November 1855 wurde sie unter der persönlichen Leitung von Eberhard Friedrich zusammen mit seinem Sohn Heinrich und drei weiteren Gehilfen in Agram aufgestellt. Der Transport der Orgel ging per Achse vor sich. Es gingen unterwegs zwei Pf erde ein infolge der oft plötzlichen und starken Temperaturschwankungen, und man brauchte auch erheblich längere Zeit, als zu Hause vorgesehen war. Auch allerlei Schäden stellten sich ein, die in Agram vom Meister selbst behoben werden mussten, weil weder seine Gehilfen noch die dortigen Handwerker dazu fähig waren.
Die Fahrt der Orgelbauer erfolgte per Eilpost über Ulm, München, Traunstein, Salzburg, Ischl, Brück, teilweise mit Tag- und Nachtfahrten in den Tagen vom 23. bis 29. August 1855. Sie wurde in einem Brief an Frau Marie Walcker sehr anschaulich geschildert. Zu den Nachtfahrten entschloss man sich, weil sonst die Reise durch das viele Übernachten — nur zum Schlafen — zu teuer geworden wäre. So berichtet er von Ischl, wo nur noch im vornehmsten Gasthof „Kaiserin Elisabeth" Unterkunft zu bekommen war, „während ich in der Stille meines Herzens den lieben Gott nur um kleines Obdach angefleht hatte, so waren im Augenblick Portier, Hausknecht und Gepäckträger alles im größten Diensteifer, uns Zimmer und Betten anzuweisen, wie sie sonst nur fürstlichen Personen bereitet zu werden pflegen . . . Ein Paar Kalbsschnitzel und ein Glas Bier war unsere ganze Abend-Restauration, womit wir uns zu Bett legten. Dessen ungeachtet musste ich zu meinem wahrhaft panischen Schrecken des Morgens früh 5 Uhr, ohne einen Kaffe zu verlangen, für uns fünf Personen 20 Gulden 24 Kreutzer bezahlen."
Dagegen wurden sie in Agram mehr wie Gäste und nicht wie Geschäftsleute behandelt. Zunächst zwar bezogen sie Quartier im Gasthaus „Jägerhorn", aber der Erzbischof hatte — er war selbst bei ihrer Ankunft in Karlsbad — angeordnet, dass sie im erzbischöflichen Schloss wohnen und in der Hausmeisterei verpflegt werden sollten. „In unserem bezogenen Quartier, dem Jägerhorn', schliefen wir nur zweimal, und schon am 31. August zogen wir mit Sack und Pack im erzbischöflichen Schloss ein, wo wir vier geräumige, möblierte Zimmer bewohnen und bei Herrn Haushofmeister einen ganz guten, mit je vier verschiedenen Speisen ausgestatteten Kosttisch haben. Den Kaffee lassen wir uns aufs Zimmer bringen, ,der ist aber famos und ausgezeichnet" Das Gabelfrühstück besteht aus ein Viertel Gigerikik oder Nierlein in der Sauce oder an Freitagen eingeschlagene Eier, Käse oder dergleichen nebst einer Flasche Wein, schmeckt ebenfalls ausgezeichnet, so dass Damion (ein dänischer Orgelbauer, der sich bei Walcker auf die selbständige Ausübung des Orgelbaues in seiner Heimat vorbereiten wollte) ganz blühend und fett wird. Mittag machen wir gewöhnlich um l Uhr, und das Abendessen genießen wir um 1/^S Uhr, wobei jedesmal Wein zur Genüge aufgestellt ist."
Sie wurden zwar auch nacheinander krank, Heinrich offenbar mit einer leichten Malaria — er bekam Chinin und Pillen — Walcker selbst mit einem großen Furunkel. Aber es war doch alles in eine so ganz andere Atmosphäre eingebettet als in Ulm; die ungute Korrespondenz von dort verfolgte ihn auch in Agram. Von dort dagegen berichtet er z. B. vom Sonntag, dem 9. September: „Nachdem wir dem Morgengottesdienst beigewohnt, aber weder von den lateinischen Messen noch von der kroatischen Predigt etwas verstanden hatten, ging ich auf mein freundliches Zimmer und hielt da eine für mein Herz sehr gesegnete Andacht. Unterdessen wurde es Mittag, und nach Tisch offerierte uns der sehr freundliche und gefällige Haushofmeister eine Spazierfahrt mit der erzbischöflichen Equipage, was wir mit Dank annahmen; so brachten uns zwei stattliche rasche Braunen in den etwa eine Stunde von Agram befindlichen, ohngefähr 2—3 Stunden langen und vielleicht ebenso breiten Park (der Hauptausflugsort der Agramer Noblessen); alles war uns mit größter Ehrerbietung zu Diensten, und sowohl im Sommerpalast als auch in der Meierei, Gärtnerei, im Bienenhaus, in der Seidenrauperei, im Schweizerhaus und im Forsthaus wurde uns alles gezeigt, so dass wir im größten Wohlbehagen des Abends wieder nach Hause fuhren."
Der Erzbischof war am 19. September zurückgekommen, am 20. vormittags hatten Vater und Sohn Walcker ihm in höchster Gala ihre Aufwartung gemacht, während der Erzbischof sie anschließend sofort in der Kirche besuchte und, als er bereits zwei Stockwerke aufgebaut sah, sich sehr erfreut äußerte. Walcker wurde während der Aufstellungszeit auch einmal zur erzbischöflichen Tafel geladen, und sowohl der Erzbischof selbst wie seine geistlichen und weltlichen Räte verfolgten den Fortgang der Geschäfte mit regstem Interesse und wohlwollendster Förderung. Zur musikalischen Prüfung und Abnahme der Orgel wurde ein Baron v. Seitz aus Wien berufen und die Einweihung selbst auf den hohen katholischen Festtag Allerheiligen, am l. November 1855, angesetzt. Sie gestaltete sich für Walcker zu einem wirklichen Triumph. Er berichtet seiner Frau darüber in einem letzten Brief aus Agram u. a.:
„Heute an dem höchsten katholischen Feste und der Installierung unserer Orgel zum Gottesdienst war große Messe, die der Hochehrwürdige Erzbischof selbst abgehalten hat; dieselbe wurde von etlichen 60 Musikern aufgeführt und mit der Orgel durch Herrn v. Seitz begleitet. Die Feierlichkeit dauerte über zwei Stunden, während welcher Zeit dem Orgelwerk durch die Kunstfertigkeit des obigen Herrn Baron alle nur möglichen Nuancen und Machtentwicklungen entlockt wurden. Nach der Feuerprobe machten wir mit Seitz zu unserer Erholung einen kleinen Spaziergang in die Anlagen des Schlosses und durch die Stadt auf die Promenade, von wo aus beinahe die ganze Stadt und Umgegend überschaut werden kann.
Jetzt ging es zur Tafel, zu welcher dem Orgelbauer und Organisten zu Ehren und 80 der höchsten Noblessen, von Banus an bis zum Stabsoffizier und bis zum letzten Domherrn und weltlichen Beamten, geladen waren. Ein Gastmahl, wie ich in meinem Leben keines gesehen habe! Und um Dir nur einen kleinen Begriff hiervon zu geben, so ist nicht zuviel gesagt, dass die Teller zum mindestens 2 5-mal gewechselt und folgende Weine aufgetischt worden sind:
1. Ein delikater kroatischer Tischwein,
2. Malaga, .
3. Schumsauer (Ungarwein),
4. Ofener Roter (vor Stärke ganz bitter),
5. Rheinwein,
6. Champagner und
7. Tokaier.
Beim Champagner wurden die verschiedensten Toaste ausgebracht: erst dem Kaiser und der Kaiserin, dann dem Banus, dann dem Erzbischof und seinem Kapitel und mit ganz besonderem Enthusiasmus vom HE. Erzbischof selbst dem Erbauer des Werkes und seinen hoffnungsvollen Söhnen: dass sie der liebe Gott noch lange erhalten und im Segen für das Reich Gottes, so wie in allen anderen Weltgegenden, auch in der Österreichischen Monarchie, wirken lassen möge? So dass ein einstimmiges ,Gott erhalte!' erscholl. Ebenso rühmlich wurde auch des Kunstspielers gedacht, dass er sich nicht habe verdrießen lassen, die weite Reise zu unternehmen. Nach der Tafel wurde Herr v. Seitz gebeten, auf den Abend wieder einen Ohrenschmaus zu geben, was er recht gerne zusagte."
Von finanziellen Dingen hatte Eberhard Friedrich in allen Briefen aus Agram nie etwas erwähnt. In dem letzten Brief wurde nur mitgeteilt, dass er am Sonntag seine Rechnung machen werde. Aus späteren Mitteilungen geht hervor, dass Walcker außer der anstandslosen Begleichung der Rechnung durch das Domkapitel vom Erzbischof persönlich noch eine silberne Ehrenmedaille und einen Ehrensold von 2000 Kronen erhielt. Außerdem ist aus Mitteilungen des Enkels, Dr. Oscar Walcker, vom Jahre 1912 ersichtlich, dass die Erinnerungen an Eberhard Friedrich Walcker noch in freundlichem Lichte weiterlebten, und dass sich diese Gefühle nach sechzig Jahren sofort auch auf den Enkel übertrugen. Es ist darum verständlich, dass Eberhard Friedrich je und dann gerne die Strapazen einer Auslandsreise und eines Auslandsaufenthalts in Kauf nahm, wenn er Vergleiche zwischen ausländischen und heimatlichen Orgelbaugeschäften anstellte.
Nur aus solcher Stimmung und Erfahrung heraus erklärt sich auch die ganz ungewöhnliche körperliche und geistige Spannkraft, die Walcker bis ins hohe Alter hinein zur Verfügung stand. Neben diesen Schwierigkeiten bei den Orgelaufstellungen wuchsen natürlich auch die allgemein geschäftlichen Aufgaben, so dass Walcker für Entlastung in der Leitung des Betriebes sorgen musste. Er trug deshalb im Jahre 1842 dem Orgelbaugehilfen Heinrich Spaich, der bis zum Jahre 1834 bei seinem Vater, Johann Eberhard Walcker, in Cannstatt tätig war und dann als Orgelbauer zu ihm kam, die Teilhaberschaft an, um durch ihn während seiner vielen Reisen von der Sorge um den Heimatbetrieb entlastet zu sein. Die Firma nannte sich von
E. Fr. Walcker & Spaich, Orgelbauer.
Inzwischen waren auch die beiden ältesten Söhne, Heinrich Walcker, geb. 1828, und Fritz Walcker, geb. 1829, als Orgelbaulehrlinge in das Geschäft eingetreten und brauchten in Vertretung des Vaters eine sachkundige Anleitung. Damit war also die dritte Generation in der Familie Walcker zum Dienst am Orgelbau angetreten, und auch die beiden Vertreter des dritten Gliedes an der Kette brachten unstreitig bestimmte Begabungen und eine starke innere Verbundenheit für den und mit dem Orgelbau mit. Es hatte sich für sie sozusagen ein familiäres Treueverhältnis gegenüber dem Orgelbau herausgebildet, das es auch für sie selbst zur Selbstverständlichkeit machte, in des Vaters Spuren zu treten. Zudem waren sie ja im kindlichen Spiel schon mit dem Orgelbau vertraut geworden, so dass der Übergang zum Ernst gar nicht so ins Bewusstsein trat. Die Reisemöglichkeiten, das Unberechenbare, immer wieder Unerwartete, das sie beim Vater sahen und das da oder dort des Dienstes ewig gleichgestellte Uhr immer wieder unterbrach, hatte für junge Menschen etwas Bestechendes. Vier von den Söhnen, die vier ältesten, sind Orgelbauer geworden und kamen im Laufe der Jahre ins väterliche Geschäft. Der jüngste Sohn, Gustav, erzählt, nach seines Vaters Willen hätten alle sieben Söhne Orgelbauer werden müssen. Er habe gegenüber dem Wunsch einiger seiner Söhne, Kaufmann werden zu wollen, vor allem ethische Bedenken geltend gemacht, dass es eine bedenkliche Sache sei, rein vom Handelsgewinn leben zu wollen. Ihm war lediglich die Warenvermittlung keine genügend ernsthafte und keine sittlich befriedigende Leistung, wenn nicht noch eine — nach seiner Auffassung — schöpferische Arbeit dahinterstehe. Umgekehrt genügte es den jüngeren der Söhne nicht mehr, nur das Bewusstsein einer hohen, selbst künstlerischen Leistung zu haben, ohne auch einen entsprechenden materiellen Gewinn zu erzielen.
Immerhin, vier der sieben Söhne wurden Orgelbauer. Es war also fachlich gesehen für eine Fortsetzung des Orgelbaues in der Familie Walcker mehr als ausreichend gesorgt, und die Führerstellung Eberhard Friedrichs sowohl seinem Teilhaber Spaich gegenüber und später, als auch die beiden ältesten Söhne zu Teilhabern erhoben wurden — es war im Jahre 1854 —, auch den Söhnen gegenüber, war unbestritten. Es hatte auch keiner denselben Höhenflug wie er, den unbändigen Schaffensdrang und die anerkannte technische, künstlerische und menschliche Autorität, wie sie sich für Eberhard Friedrich allmählich herausgebildet hatte. Spaich war eine wesentlich unkompliziertere Natur als Walcker, war weder von dem schweren weltanschaulichen Ernst umlagert, noch so stark einem höheren Auftrag verpflichtet. Er hatte ein heiteres, geselliges und gewinnendes Wesen. Ihm ist darum manches Geschäft leichter zugeflossen, weil die Menschen eher zu ihm den Weg fanden als zu Walcker, mit ihm sich je und je auch schneller einigen konnten. Die Söhne wurden, nachdem sie in allen Zweigen des Orgelbaues gründlich eingearbeitet waren, sowohl was die Holz- wie die Metallbearbeitung anbelangt, insbesondere auch mit der Seele der Orgel, der Intonation, sowie allen sonstigen musikalischen und technischen Fertigkeiten, den Fragen der Akustik usw., sicher vertraut gemacht, viel im Außendienst, Aufstellung neuer Orgeln, Stimmung, Reparatur, Umbau alter Orgeln im In- und Ausland verwendet. Dort stellten sie auch vollkommen ihren Mann, und die Firma konnte ihnen jede Aufgabe überlassen. Sie konnten auch Pläne, Dispositionen, Kostenberechnungen für neue Orgeln jederzeit und für jedes Bedürfnis ausarbeiten und Interessenten beraten. Kurz, sie waren im Orgelbau durchaus auf der Höhe, aber sie hatten nicht den unbändigen Tätigkeitsdrang und auch nicht den allezeit bereiten Willen zu neuen Reformen wie der Vater Eberhard Friedrich. Es hätte sich wohl jedem der beiden ältesten Söhne in diesem oder jenem Teil der zivilisierten Welt die Möglichkeit geboten, für einen bestimmten Kulturkreis Träger, Former und Verbreiter der Orgelbaukunst und der Orgelkunst überhaupt zu werden, aber dazu fehlte es an der notwendigen Initiative. Der kühne, selbständige Wagemut, der zum erfolgreichen Unternehmen gehört und den Eberhard Friedrich in sehr hohem Maße besaß, fehlte ihnen. Aus Briefen, die zwischen Vater und Söhnen gewechselt wurden, geht hervor, dass der Vater über diesen Mangel manchmal ungehalten war, mangelndes Interesse, mangelndes Verantwortungsgefühl, ja sogar mangelnde Sohnestreue unterstellte, wo es sich einfach um andersartige Veranlagung der Söhne im Vergleich zum Vater handelte. Dazu kamen mit der Zeit allerdings auch noch Schwierigkeiten finanzieller Art. Eberhard Friedrich hatte mit neun Kindern eine sehr große und kostspielige Familie, während Spaich mit seiner kleinen Familie wesentlich billiger lebte. Nun waren aber beide am Reingewinn zu gleichen Teilen berechtigt, während die Lasten des Betriebes in weit höherem Maß auf den Schultern Walckers lagen. Hier hatte beim Abschluss des Teilhabervertrags der Kaufmann gefehlt. Das wurde zwar später nachgeholt, aber erst als Walcker lange Jahre im Nachteil gewesen war. Der neue Gesellschaftsvertrag, der nun auch die beiden Söhne umfasste, nahm auf diese Verhältnisse mehr Rücksicht zum Vorteil Eberhard Friedrichs, aber damit notwendigerweise zu Lasten der übrigen Teilhaber.
Nun berichtet der jüngste Sohn, dass ihr Vater es seiner Familie gegenüber an nichts habe fehlen lassen, und so sind auch die erwachsenen Söhne mit bestimmten Vorstellungen einer guten bürgerlichen Familie an die Gründung eines eigenen Hausstandes herangegangen, dessen Kosten manchmal über das hinausgingen, was ihnen aus der Teilhaberschaft an der Firma zufloss. So gab es manche Reibung zwischen Vater und Söhnen, die dann freilich meist auf Kosten einer gesunden Finanzgebarung der Firma ausgeglichen wurden, für das Fundament derselben aber nicht ersprießlich waren. Die Firma selbst hieß seit dem Jahre 1854
E. Fr. Walcker & de.. Ludwigsburg.
Solange der Vater an der Spitze stand, ging es; denn sein Name hatte eine Werbekraft, die manche finanzielle Schwäche des Unternehmens weit aufwog. Eberhard Friedrich hatte durchaus recht, wenn er seinen Söhnen sagte: „Das beste, was ich Euch hinterlasse, ist der gute Name, aber er ist — wie alle Erfahrung lehrt — nur sehr bedingt vererblich." Tatsächlich war der Name Walcker damals schon ein weit über Deutschland hinaus reichender Begriff geworden. Es kam vor, dass Briefe an den „Orgelmacher Walcker in Deutschland" den Adressaten erreichten.
Ende der sechziger Jahre, als er müde zu werden schien, hat Eberhard Friedrich seinen Sohn Karl, der jahrelang als Kaufmann in Paris tätig war und auf den Ruf des Vaters wartete, zurückgeholt. In jenen Jahren waren auch noch zwei weitere Söhne, Paul Walcker, geb. 1846, und Eberhard Walcker, geb. 1850, in das väterliche Geschäft eingetreten, so dass einige Zeit neben dem Vater fünf Söhne — vier als Orgelbauer und einer als Kaufmann — in der Firma tätig waren. Gerade der Kaufmann sollte noch unter der Führerschaft des Vaters Gelegenheit haben, sich in die besonderen Verhältnisse eines Großbetriebes im Orgelbau einzuleben. Orgeln sind kein Massenartikel, die man im Serienbau und für Unbekannt herstellen und auf den Markt bringen kann. Darum kann man die Werbung für den Orgelbau auch nicht einfach einem Reisenden übertragen; nur wer selbst Meister und Künstler im Orgelbau ist, kann die Werbung übernehmen. Das steigerte sich noch mit der wachsenden Verschiedenartigkeit und Vielgestaltigkeit in der Verwendung der Orgel, die über ein rein kirchliches Instrument inzwischen hinausgewachsen war. Es ist also eine Spezialisierung für die leitenden Persönlichkeiten wie in sonstigen Betrieben nicht möglich und darum auch die Hereinnahme so vieler gleichberechtigter Teilnehmer nicht eben einfach.
|